In der heutigen digitalen Landschaft sind moderne Unternehmen zunehmend Schwachstellen ausgesetzt – ein Risiko, das kontinuierlich zunimmt. Die Zahl der CVEs wächst weiterhin exponentiell und hat im letzten Jahr 22.000 überschritten. Dies zwingt Unternehmen dazu, Schwachstellen proaktiver zu verwalten. Wenn dieses Cyberrisiko nicht gemanagt wird, stellt es eine erhebliche Bedrohung für die Betriebskontinuität, die Datenintegrität, die finanzielle Gesundheit und sogar den Ruf des Unternehmens dar. Wenn sich Netzwerkgrenzen weiterentwickeln und Anwendungen an Zahl und Komplexität zunehmen, wird es wichtig zu bestimmen, wo der Schwerpunkt zwischen Schwachstellenmanagement und Risikomanagement liegen soll. Bei richtiger Anwendung wirken diese Strategien harmonisch zusammen, um unmittelbare Risiken zu mindern und langfristige Nachhaltigkeit aufzubauen.
In diesem Artikel untersuchen wir die Unterschiede zwischen Schwachstellenmanagement und Risikomanagement sowie die Bereiche, in denen sie sich ergänzen. Wir werden kurz die konzeptionellen Definitionen, charakteristischen Merkmale, wichtigsten Unterschiede und einige Best Practices betrachten. Anstelle eines Alles-oder-Nichts-Ansatzes funktioniert eine ausgewogene Kombination beider Ansätze harmonisch, wodurch Ausnutzungsmöglichkeiten reduziert und Ressourcen optimal zugewiesen werden. Durch das Erkennen dieser Unterschiede können Teams ein starkes Sicherheitsframework aufbauen, das sowohl technologische Schwachstellen als auch organisatorische Risiken umfasst.
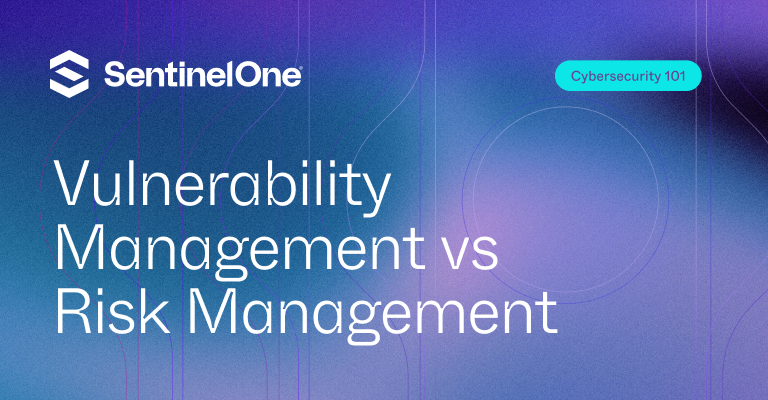
Was ist Schwachstellenmanagement?
Eine durchgeführte Studie unter 200 Führungskräften aus dem Bereich Cybersicherheit in Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar ergab, dass 40 % der Befragten einen Vorfall erlebt haben, der zu einer Sicherheitsverletzung führte, wobei 38 % von ihnen 1–3 solcher Angriffe erlebt haben. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Angreifer solche Schwachstellen aktiv ausnutzen und das Risiko des Schwachstellenmanagements zu einer Priorität auf Führungsebene wird.
Einfacher ausgedrückt umfasst das Schwachstellenmanagement die Identifizierung von Schwachstellen in Software, Hardware und Netzwerken und deren anschließende systematische Behebung. Mit dem Fokus auf kontinuierlichem Scannen, der Priorisierung von Korrekturen und der Überprüfung der Wirksamkeit der Änderungen soll es die Ausnutzungsfenster schließen. Oft korrelieren Scan-Engines oder maßgeschneiderte Software jede identifizierte Schwachstelle mit Schweregrad-Metriken (wie CVSS), die als Grundlage für Korrekturprozesse dienen. Durch die Integration von Schwachstellenbewertung und Risikomanagement in umfassendere Praktiken wird sichergestellt, dass die identifizierten Mängel ohne übermäßigen Ressourcenaufwand behoben werden.
Wichtige Merkmale des Schwachstellenmanagements
Obwohl die Suche nach Anwendungen ohne Patches oder falsch konfigurierten Systemen das Hauptziel des Schwachstellenmanagements ist, umfasst es auch die kontinuierliche Überwachung, die automatische Bereitstellung von Patches und die Erstellung detaillierter Berichte. Diese Elemente stärken die Fähigkeit des Unternehmens, schnell zu reagieren, und verringern so die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs. Wenn die Erkennung mit einem organisierten Korrekturprozess synchronisiert wird, kann eine Verbindung zwischen Risikomanagement und Schwachstellenmanagement hergestellt werden. Hier sind fünf wichtige Merkmale eines guten Schwachstellenmanagements:
- Automatische Erkennung von Assets: Es kommt selten vor, dass Unternehmen ihre gesamten Hardware- und Software-Assets manuell verwalten. Neue Server, IoT-Geräte oder kurzlebige Container werden von den Tools automatisch erkannt. Es ist entscheidend, sich über die Details jedes Knotens im Klaren zu sein, um sicherzustellen, dass die Patch-Abdeckung konsistent bleibt. Ohne diese Fähigkeit werden blinde Flecken zu den primären Eindringungspunkten, wodurch Patch-Zyklen nutzlos werden.
- Geplante und kontinuierliche Scans: Tägliche Scans helfen dabei, Schwachstellen kurz nach ihrem Auftreten zu erkennen, im Gegensatz zu monatlichen Scans, die Monate dauern. Die meisten hochentwickelten Lösungen arbeiten mit CI/CD-Pipelines zusammen, um neu bereitgestellten Code zu überprüfen. Einige folgen auch einem "kontinuierlichen Scan"-Modell Modell und sind mit risikobasierten Frameworks für das Schwachstellenmanagement verbunden. Eine konstante Abdeckung verkürzt auch die Zeit zwischen der Erkennung eines Problems und der Implementierung der Lösung.
- Kategorisierte Schweregradbewertungen: Die Entscheidung, jeden Fehler als kritisch, hoch, mittel oder niedrig einzustufen, bestimmt den Umfang der einzusetzenden Ressourcen. Sich jedoch nur auf den Schweregrad zu konzentrieren, ist nachteilig, da dies zu einer Anhäufung dringenderer Aufgaben führt. Daher werden Schweregradbewertungen häufig mit Risikomodellen für das Schwachstellenmanagement kombiniert, die das Ausnutzungspotenzial oder die Auswirkungen auf das Geschäft berücksichtigen. Diese mehrschichtige Methodik hilft zu verhindern, dass jedes mittelmäßige Problem mit der gleichen Intensität wie kritische Probleme behandelt wird.
- Patch-Tests und -Bereitstellung: Das Schwachstellenmanagement erfordert auch Best Practices für das Patch-Management, wie z. B. einen Patch-Bereitstellungsprozess, Tests und einen Plan B für den Fall, dass ein Patch die Produktionssysteme beeinträchtigt. Diese Tools tragen dazu bei, die Reibungsverluste zwischen den DevOps-, IT- und Sicherheitsteams zu verringern. Langfristig schafft ein optimiertes Patch-Management eine stabile Umgebung, in der Exploit-Fenster nicht lange bestehen bleiben können.
- Validierung und Berichterstattung von Korrekturen: Es ist ebenso wichtig sicherzustellen, dass jede Korrektur die Schwachstelle tatsächlich behebt. Tools führen manchmal auch erneute Scans durch oder protokollieren Patch-Ergebnisse, um den Prozentsatz des Erfolgs zu überprüfen. Eine detaillierte Berichterstattung trägt dazu bei, die Verantwortlichkeit sicherzustellen, Audit-Anforderungen zu erfüllen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. Durch die Untersuchung der Patch-Rate und der Häufigkeit wiederkehrender Schwachstellen können Unternehmen somit Problembereiche identifizieren, die zur Optimierung nachfolgender Prozesse beitragen können.
Was ist Risikomanagement in der Cybersicherheit?
Ein umfassenderer Blick auf das Risikomanagement umfasst die Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Risiken, die erhebliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben. Laut einer Umfrage unter 1.200 Führungskräften von gewerblichen Versicherungen in den Vereinigten Staaten ist das am häufigsten genannte Risiko die anhaltende und dynamische Cyber-Bedrohung. Dies unterstreicht die Tatsache, dass Risikomanagement nicht im Widerspruch zum Schwachstellenmanagement steht, sondern vielmehr einen abgestimmten Ansatz darstellt: Risikomanagement befasst sich mit der strategischen Ressourcenzuweisung, der Planung für Notfälle und der Bedrohungsbewertung. Während sich das Schwachstellenmanagement auf technische Schwächen konzentriert, deckt das Risikomanagement alle Aspekte einer Organisation ab, einschließlich interner Kontrollen, Dritter und externer Faktoren. Es geht über das einfache Ausbessern von Code hinaus und berücksichtigt Reputationsverluste, Compliance-Strafen oder sogar Systemausfälle. Schließlich richtet es die Ziele und Vorgaben der Organisation auf das Management von Risiken aus, die die Erreichung missionskritischer Ziele beeinträchtigen könnten.
Wichtige Merkmale des Risikomanagements
Risikomanagement bewegt sich von der taktischen Ebene des Patchings auf die strategische Ebene der Unternehmensperspektive und koordiniert die Identifizierung, Bewertung und Planung des Umgangs mit Störungen. Da Bedrohungen vielfältig sind und alles von Angriffen auf die Lieferkette bis hin zu Schäden für den Ruf der Marke umfassen können, muss das Risikomanagement eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit beinhalten. Hier sind fünf Schlüsselkomponenten, die einen soliden Plan für das Cybersicherheits-Risikomanagement ausmachen:
- Risikoidentifizierung: Das Risikomanagement sucht nach Schwachstellen in der Umgebung, von der Identifizierung von Marktveränderungen bis zur Bewertung von Insider-Bedrohungen. Es ermittelt auch, ob bestimmte Prozesse oder Lieferantenbeziehungen Risiken verschärfen. In Kombination mit der Schwachstellenbewertung und der Integration des Risikomanagements stellt es sicher, dass keine Schwachstellen verborgen bleiben. In diesem Fall bildet eine gründliche Identifizierung die Grundlage für die Risikoreaktionsstrategie.
- Risikoanalyse und Priorisierung: Jedes Risiko wird dann nach den potenziellen Auswirkungen und der Wahrscheinlichkeit seines Eintretens eingestuft. Während ein kleiner Ausfall eines Rechenzentrums mittlere Schäden verursachen kann, ist ein weltweiter Reputationsverlust für die Marke unvermeidlich. Dies hilft der Unternehmensleitung zu wissen, welche Bedrohungen in ihren Reaktionsplänen Priorität haben sollten. Tools und Frameworks wie NIST oder ISO helfen in der Quantifizierungsphase dabei, sicherzustellen, dass verschiedene Risiken auf die gleiche Weise gemessen werden.
- Risikoreaktionsplanung: Angenommen, ein Risiko wurde identifiziert, dann hat das Unternehmen die Möglichkeit, es entweder zu akzeptieren, zu reduzieren, zu übertragen oder zu vermeiden. Während die Risikominderung die Installation von Sicherheitskontrollen oder den Erwerb neuer Technologien beinhalten kann, erfolgt die Übertragung häufig über eine Cyberversicherung. In Verbindung mit einem risikobasierten Ansatz zum Schwachstellenmanagement stehen Patches oder System-Upgrades im Einklang mit dem Gesamtrisikoprofil. Durch die Dokumentation wird sichergestellt, dass jede Auswahl angemessen und leicht zu erklären ist.
- Kommunikation und Berichterstattung: Cyberbedrohungen sind komplex und erfordern von Risikomanagern eine erfolgreiche Kommunikation sowohl mit dem technischen Personal als auch mit der Geschäftsleitung. Executive Reports und Briefings werden visuell als Dashboards dargestellt, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse einer Analyse im geschäftlichen Kontext kommuniziert werden. Dies hilft dabei, Genehmigungen für Budgets, Neueinstellungen oder die Umsetzung von Richtlinien zu erhalten. Die Transparenz des Risikostatus beeinflusst auch die interne Risikokultur und fördert Verantwortungsbewusstsein und Anpassungsfähigkeit.
- Kontinuierliche Überwachung und Verbesserung: Bedrohungen ändern sich mit der Zeit, sodass eine starre Richtlinie nach einiger Zeit irrelevant wird. Durch kontinuierliche Überprüfungen werden Veränderungen der Umstände erfasst, wie z. B. Markteintritte, Maßnahmen von Wettbewerbern oder zuvor unbemerkte Bedrohungen. Es ist wichtig, die Risikostrategie nahezu in Echtzeit anzupassen, damit sie mit der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslage Schritt hält. Diese Verbesserungen schaffen nach und nach einen Resilienzzyklus, in dem tägliche Schwachstellendaten in übergeordnete Risikoziele einfließen.
Unterschied zwischen Schwachstellenmanagement und Risikomanagement
Obwohl beide Bereiche mit der Verbesserung der Sicherheit zu tun haben, unterscheiden sie sich in ihrem Umfang und ihren Zielen. Der Vergleich zwischen Schwachstellenmanagement und Risikomanagement zeigt, dass jeder Bereich unterschiedliche Aspekte abdeckt: Das Schwachstellenmanagement konzentriert sich eher auf konkrete technische Probleme, während das Risikomanagement andere Aspekte einer Organisation berücksichtigt. Um die Unterschiede hervorzuheben, werden in diesem Abschnitt neun Aspekte behandelt, die von der Abdeckung der Vermögenswerte bis zur Ergebnismessung reichen.
- Umfang der Abdeckung: Das Schwachstellenmanagement konzentriert sich auf bestimmte Aspekte von Software- oder Hardwarefehlern – Bugs, Konfigurationsfehler, veraltete Versionen. Das Risikomanagement hingegen umfasst die gesamte Organisation und kann auch Nicht-IT-Risiken wie das Markenimage oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften umfassen. Auf diese Weise wird das Risiko des Schwachstellenmanagements in einen größeren Zusammenhang gestellt, sodass der Entscheidungsträger sofortige Patch-Aufgaben im Zusammenhang mit den Zielen der Organisation bearbeiten kann.
- Zeithorizont: Schwachstellenprozesse werden meist in Zyklen durchgeführt, in der Regel wöchentlich, monatlich oder kontinuierlich, je nach den Anforderungen der Organisation. Das Risikomanagement erstreckt sich jedoch über Monate oder Jahre und berücksichtigt dabei die Strategien der Organisation. Der kurze Zeitrahmen eignet sich für Patch-Zyklen, während der lange Zeitrahmen groß angelegte Veränderungen wie Übernahmen oder Änderungen von Richtlinien widerspiegelt.
- Dateneingaben: Ein Ansatz zur Schwachstellenbehebung stützt sich auf Scan-Berichte, Schweregradmetriken und die Verfügbarkeit von Patches. Risikomanagement-Frameworks extrahieren Informationen aus Bedrohungsinformationen, regulatorischen Anforderungen, Wettbewerbsanalysen und Finanzmodellen. Beide stützen sich auf unterschiedliche Datensätze, um Entscheidungen zu treffen, aber ihre Integration führt zu einer effizienteren Priorisierung.
- Einbindung von Stakeholdern: Das Team für das Schwachstellenmanagement kann aus Sicherheitsingenieuren, Systemadministratoren oder DevOps-Mitarbeitern bestehen. Das Risikomanagement umfasst Personen wie Führungskräfte, Rechtsberater, Finanzpersonal und externe Wirtschaftsprüfer. Diese Beziehung zwischen Risikomanagement und Schwachstellenmanagement spiegelt sich darin wider, wie umfassend jede Disziplin Entscheidungen integrieren muss.
- Arten von Strategien zur Risikominderung: Die Risikominderung umfasst die Behebung von Softwarefehlern, was Patches, Neukonfigurationen oder Upgrades. Risikobasierte Strategien können auch den Abschluss von Versicherungen, die Neugestaltung von Prozessen oder die Verlagerung von Geschäftsaktivitäten umfassen. Während beide Ansätze potenzielle Schäden minimieren, kann der letztere nicht-technische Lösungen beinhalten, wie z. B. Änderungen im Vertrag mit einem Lieferanten oder die Erstellung neuer Marketingkampagnen, um das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen.
- Fokus auf technische vs. strategische Aspekte: Das Schwachstellenmanagement ist sehr technisch und umfasst Themen wie Patch-Zyklen, Code-Überprüfungen oder Protokollierung. Das Risikomanagement ist strategischer und umfasst auch potenzielle Folgen, die nicht direkt messbar und greifbar sind, wie z. B. Imageschäden oder Unterbrechungen der Lieferkette. Durch ihre Integration kann sichergestellt werden, dass technische Lösungen mit der allgemeinen Geschäftslogik in Einklang stehen, wodurch unnötige Ausgaben vermieden werden.
- Automatisierungsmöglichkeiten: Der Schwachstellenscan und die Patch-Management-Prozesse können in hohem Maße automatisiert werden. Im Gegensatz dazu kann das Risikomanagement ein umfangreicherer Prozess sein, der einen menschenzentrierten Ansatz und Modellierung erfordert. Die Kombination aus automatisiertem Scannen von Schwachstellen und menschlicher Überwachung für Entscheidungen auf Unternehmensebene führt zu einem moderaten Sicherheitsniveau. Es gibt jedoch ein Konzept namens "risikobasiertes Schwachstellenmanagement", das einige Aspekte beider Ansätze für eine agile Reaktion auf Bedrohungen kombiniert.
- Metriken und KPIs: Schwachstellenteams verfolgen die Patch-Durchlaufzeit oder das Verhältnis zwischen kritischen Korrekturen und Erkennungen. Risikomanager überwachen allgemeinere Kennzahlen – Compliance-Raten, mögliche Verluste oder unterbrochene Lieferketten. Dieser Unterschied bestimmt, wie jede Disziplin Budgets oder Erfolge verteidigt. Die Verknüpfung von Risikokennzahlen mit Verbesserungen der Schwachstellen hilft zu erklären, wie technische Fortschritte zu einer geringeren Gefährdung des Unternehmens führen.
- Endziel: Im Schwachstellenmanagement ist Erfolg der Zustand, in dem weniger unbehandelte Schwachstellen vorhanden sind, um die Zeit zu reduzieren, die Angreifer haben, um diese auszunutzen. Zu den wichtigsten Aspekten des Risikomanagements gehören die operative Stabilität, die Verlustreduzierung sowie die langfristige Wahrung des Markenimages. Beide sind am Schutz der Widerstandsfähigkeit von Organisationen beteiligt, tun dies jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven.
Schwachstellenmanagement vs. Risikomanagement: 9 entscheidende Unterschiede
Da im obigen Abschnitt die konzeptionellen Unterschiede erläutert wurden, werden diese in der folgenden Tabelle noch einmal übersichtlich dargestellt. Dieser Vergleich zeigt, worin sich das Schwachstellenmanagement vom Risikomanagement in Bezug auf Umfang, Zeit, Teilnehmer und andere Aspekte unterscheidet. Zur besseren Übersichtlichkeit haben wir hier neun Kategorien aufgeführt.
| Aspekt | Schwachstellenmanagement | Risikomanagement in der Cybersicherheit |
|---|---|---|
| Primärer Schwerpunkt | Behebung und Korrektur einzelner Software-/Hardwarefehler | Identifizierung und Minderung allgemeiner organisatorischer Bedrohungen |
| Strategisch vs. technisch | Überwiegend technisch, abhängig von Scan-Zyklen | Strategisch und funktionsübergreifend, abgestimmt auf die Geschäftsziele |
| Zeithorizont | Kurze Scan-Intervalle (täglich, wöchentlich, monatlich) | Langfristige Planung (Monate/Jahre), Aktualisierung entsprechend der Entwicklung des Geschäfts oder der Bedrohungslage |
| Dateneingabe | CVSS-Bewertungen, Patch-Hinweise, Scan-Ergebnisse | Bedrohungsinformationen, Compliance-Vorgaben, Finanzrisikomodelle, Wettbewerbsanalyse |
| Rollen der Stakeholder | Sicherheitsadministratoren, DevOps, Patch-Management-Teams | Führungskräfte, Rechtsabteilung, Finanzabteilung, Abteilungsleiter, Risikokomitees |
| Lösungsansätze | Software-Patches, Konfigurationsänderungen, erneute Scans | Versicherungen, strategische Richtlinienänderungen, Einführung neuer Technologien oder Lieferantenmanagement |
| Automatisierbarkeit | Hohe Automatisierbarkeit: Scannen, Ticketgenerierung, Patch-Verteilung | Eingeschränkt: Erfordert umfangreiche menschliche Beurteilung, Szenarioanalyse und externe Daten |
| KPIs/Erfolgskennzahlen | Patch-Geschwindigkeit, Anzahl offener Schwachstellen oder Exploit-Fenster | Reduzierung des finanziellen Risikos, Marken-/Reputationskennzahlen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Gesamtrisikobewertung |
| Endziel | Minimierung ungepatchter Schwachstellen, Verringerung der Ausnutzungsmöglichkeiten | Sicherung der Geschäftskontinuität, Erhalt des Vertrauens in die Marke, Verringerung des Gesamtrisikos |
Aus der Tabelle geht hervor, dass es erhebliche Unterschiede zwischen Schwachstellenmanagement und Risikomanagement gibt. Dennoch ergänzen sich beide Bereiche an ihren Schnittstellen. Das Schwachstellenmanagement fördert taktischere und schnellere Lösungen für das Problem, bei denen die Schwachstellen der Software nicht lange offen und ungeschützt bleiben. Das Risikomanagement erweitert diese Sichtweise um die Frage, wie diese Korrekturen in Geschäftspläne, Budgets und Compliance-Anforderungen passen. Bei richtiger Koordination sind Sicherheitsentscheidungen fundierter und konzentrieren sich auf die Bereiche, die für das Unternehmen von Bedeutung sind. Das Endergebnis ist eine kohärente Strategie, die aktuelle technische Risiken angeht und gleichzeitig Worst-Case-Szenarien vermeidet. Darüber hinaus verbessert die Integration von Schwachstellendaten in Risikomanagement-Frameworks die Synchronisation der Bemühungen zwischen IT, Sicherheit und Führungskräften. Dies führt zu geringeren Ausgaben, weniger Krisen und einer stärkeren Position gegenüber allen Widrigkeiten innerhalb des Unternehmens.
Wie kann SentinelOne helfen?
SentinelOne Singularity™ Cloud Security ist eine verbesserte Lösung, die die Lücke zwischen Unkenntnis über Schwachstellen und Echtzeit-Bedrohungsmanagement schließt. Durch einen risikobasierten Ansatz für das Schwachstellenmanagement erhalten Unternehmen einen detaillierten Überblick darüber, welche Schwachstellen am kritischsten sind. Dieser Ansatz integriert Daten aus Scans, Bedrohungsinformationen und Cloud-Posture-Checks und ermöglicht es ihnen, sich auf kritische Probleme zu konzentrieren. Im Folgenden werden fünf Faktoren beschrieben, die zeigen, wie die Plattform von SentinelOne moderne Sicherheitsprobleme löst:
- Einheitliche Cloud-Transparenz: Singularity Cloud Security bietet eine cloudnative Echtzeit-CNAPP, die Workloads von der Erstellungsphase bis zur Laufzeit schützt. Es ermöglicht eine einheitliche Verwaltung von lokalen, öffentlichen und hybriden Cloud-Umgebungen unter Einhaltung der Richtlinien. Ohne Einschränkungen hinsichtlich der Abdeckung unterstützt es Container, virtuelle Maschinen und serverlose Architekturen. Diese umfassende Übersicht ermöglicht es Teams, mögliche Risiken in allen ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu überwachen.
- Autonome Erkennung von Bedrohungen: Lokale KI-Engines sind ständig aktiv und suchen nach Prozessen, die potenziell ungepatchte Schwachstellen ausnutzen könnten. Auf diese Weise erhöht SentinelOne die Geschwindigkeit der Identifizierung und minimiert gleichzeitig Fehlalarme, indem es Verhaltensweisen und Scandaten miteinander korreliert. Dies stärkt die Risikostrategien für das Schwachstellenmanagement, indem es gewährleistet, dass bekannte Hochrisikofehler genau überwacht werden. Durch die Verhinderung von Laufzeit-Exploits wird die Zeit, die potenziellen Angreifern zur Kompromittierung eines Systems zur Verfügung steht, erheblich minimiert.
- Risikopriorisierung und verifizierte Exploit-Pfade™: Die Singularity-Plattform berücksichtigt die Wahrscheinlichkeit eines Exploits, die Bedeutung einer Ressource und die Schwere des Problems, sodass Teams Schwachstellen mit hoher Priorität priorisieren können. Verifizierte Exploit-Pfade definieren die tatsächlichen Pfade, die ein Angreifer nehmen kann, und verbinden so das Risikomanagement mit dem Schwachstellenmanagement. Dadurch wird die kontextbasierte Perspektive zu einer Pipeline von der Erkennung bis zur Behebung, die Ressourcen effizient nutzt. Patches werden daher dort angewendet, wo sie die größte Wirkung erzielen.
- Hyperautomatisierung und Echtzeitreaktion: Es ist wichtig, schneller auf Bedrohungen zu reagieren. SentinelOne Singularity™ ermöglicht die schnelle Verteilung von Patches oder Richtlinienänderungen und minimiert so effektiv die Zeit, die ein Angreifer benötigt, um eine Schwachstelle auszunutzen. Zusätzliche Funktionen wie die Unabhängigkeit vom Kernel oder die Verfügbarkeit von Tools zur Behebung von Fehlkonfigurationen aus der Ferne tragen ebenfalls zur Zuverlässigkeit bei. Durch die Integration der Lösung in die täglichen Aufgaben werden zeitaufwändige manuelle Prozesse minimiert, sodass sich die Mitarbeiter auf risikobasierte Entscheidungen konzentrieren können.
- Umfassendes Cloud Security Posture Management: Neben der Suche nach Software-Schwachstellen identifiziert die Lösung von SentinelOne auch Fehlkonfigurationen, Ungleichheiten bei Identitätsberechtigungen oder die Offenlegung von Geheimnissen. Dieser umfassendere Ansatz steht im Einklang mit dem Konzept, Schwachstellenbewertung und Risikomanagement miteinander zu verknüpfen, sodass Probleme im Bereich Compliance oder Identität erfasst werden. Container- und Kubernetes-Sicherheitsmanagement (KSPM) und External Attack Surface Management (EASM) werden in den Schutzbereich aufgenommen, wodurch ein Schutznetz entsteht, das alle Aspekte der Cloud abdeckt, von vorübergehenden Anwendungen bis hin zur Langzeitspeicherung.
Fazit
Das Schwachstellenmanagement und das Risikomanagement sind zwei wichtige Aktivitäten, die Teil des Cybersicherheitsprozesses sind und jeweils unterschiedliche Ebenen von Computersystemen schützen. Es ist daher wichtig zu verstehen, dass das Schwachstellenmanagement nicht im Widerspruch zum Risikomanagement steht, sondern dass sich beide Bereiche gegenseitig ergänzen. Die Reduzierung von Schwachstellen verringert die Wahrscheinlichkeit, dass diese kurzfristig ausgenutzt werden, indem Schwachstellen kontinuierlich identifiziert und behoben werden. Gleichzeitig betrachtet das Risikomanagement diese Korrekturen aus einer breiteren Perspektive in einem strategischen Kontext und berücksichtigt dabei finanzielle, reputationsbezogene und betriebliche Konsequenzen. Diese gegenseitige Abhängigkeit fördert eine rationale Verteidigungsstrategie und verhindert so, dass ein Ansatz den anderen dominiert.
Unternehmen, die sowohl die Perspektive des Schwachstellenmanagements als auch die des Risikomanagements einnehmen, synchronisieren die kurzfristigen technischen Behebungszyklen mit den übergeordneten Unternehmenszielen, um Redundanzen und Ineffizienzen zu vermeiden. Risikobasierte Schwachstellen stellen sicher, dass Sicherheitsteams nicht mit einem "Patch-alles"-Ansatz überfordert werden und sich gleichzeitig auf die kritischsten Probleme konzentrieren können. Langfristig führt die Zusammenarbeit von Schwachstellenscans und risikobasierter Planung zu greifbaren Ergebnissen, darunter eine Verringerung offener Schwachstellen, weniger Sicherheitsverletzungen und eine Verbesserung der Markenreputation.
Bringen Sie Ihre technische Bedrohungsprävention und Ihr strategisches Risikomanagement mit SentinelOne Singularity™ Cloud Security auf ein neues Niveau. Profitieren Sie von einer zentralen Übersicht, Bedrohungsinformationen in Echtzeit und Automatisierung, um Patching-Aktivitäten mit Schutz auf Unternehmensniveau zu synchronisieren. Fordern Sie jetzt eine Demo an!
"FAQs
Das Schwachstellenmanagement konzentriert sich auf die Identifizierung und Behebung aktueller Software- und Hardwareprobleme sowie auf die Suche nach bekannten Problemen und Lösungen. Das Risikomanagement hingegen befasst sich mit den Risiken des Unternehmens, die verallgemeinert sind und finanzielle, reputationsbezogene und operative Risiken umfassen. Während Ersteres technischer Natur und kurzfristig ist, ist Letzteres strategischer Natur und berücksichtigt das externe Umfeld, Branchenvorschriften und Unternehmensziele.
Das Schwachstellenmanagement, das den Prozess der regelmäßigen Suche, Erkennung und Behebung von Schwachstellen umfasst, schränkt die Möglichkeiten eines Angreifers ein, unberücksichtigte Risiken auszunutzen. Dadurch wird der Spielraum eingeschränkt, in dem sich Angreifer im Netzwerk bewegen oder Chaos anrichten können. In Verbindung mit Risikomanagement werden zunächst die Worst-Case-Szenarien angegangen, was zu einer viel engeren Integration von technischer Arbeit und übergeordneten Zielen führt.
Risikobasiertes Schwachstellenmanagement kombiniert die Schwachstellenbewertung mit der Risikobewertung und behandelt die Schwachstellen auf der Grundlage ihrer Risikofaktoren, wie z. B. der Wahrscheinlichkeit eines Exploits, der Bedeutung der Ressource oder der Auswirkungen der potenziellen Bedrohung. Es geht über einfache Schweregradbewertungen hinaus und integriert tatsächliche Bedrohungsszenarien, wie z. B. Exploit-Kits, in den Bewertungsprozess. Auf diese Weise werden die Ressourcen dort konzentriert, wo sie am effektivsten sind, um die Schwachstellen zu beheben, die für die schlimmsten Folgen am anfälligsten sind.
Die Schwachstellenbewertung liefert eine Liste potenzieller Probleme und eine Bewertung der Schwachstellen, während das Risikomanagement diese Probleme je nach ihren möglichen Auswirkungen auf das Unternehmen oder den Betrieb priorisiert. Zusammen bilden sie einen Rahmen, der taktische Lösungen mit strategischen Fragen in Einklang bringt, was bedeutet, dass Korrekturen sich mit den Risiken befassen, die den Wert wertvoller Vermögenswerte gefährden oder die Einhaltung von Vorschriften behindern könnten.
Eine Schwachstelle bezieht sich auf bestimmte technische Mängel oder Systemfehlkonfigurationen. Risiken umfassen das Gesamtbild und beinhalten die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Angriffs und der möglichen Folgen, die von finanziellen Verlusten bis hin zu Reputationsschäden reichen können. In Kombination können sie dazu führen, dass wichtige Bedrohungen innerhalb eines Unternehmens nicht erkannt oder unbedeutende Schwachstellen überbewertet werden. Auf diese Weise wird die Gesamtsicherheit des Unternehmens geschützt und es kommt zu keinen Überschneidungen bei den Sicherheitsinvestitionen.
Unternehmen können Scandaten mit einer Analyse der Auswirkungen auf das Geschäft zusammenführen und Echtzeit-Bedrohungsinformationen in die Priorisierung von Patches einbeziehen. Sicherheits- und Führungsteams legen einheitliche Ziele und Risikotoleranzen für alle Funktionsbereiche fest. Durch diese Abstimmung kann sichergestellt werden, dass jede entdeckte Schwachstelle im Kontext des akzeptablen Risikoprofils, der Kosten und der Compliance behandelt wird.
Ja. Schwachstellenmanagement kann als Teilbereich des Risikomanagements betrachtet werden, das sich mit der Identifizierung und Behebung von IT-Schwachstellen befasst. Risikomanagement beschränkt sich nicht nur auf finanzielle Risiken, sondern kann auch Lieferketten- oder Betriebsrisiken umfassen. Durch die Integration des Schwachstellenmanagements in das Risikomanagement werden wichtige Schwachstellen im Kontext der Ziele und Vorgaben der Organisation behoben.
Chief Information Security Officers fördern in der Regel einen risikobasierten Ansatz für das Schwachstellenmanagement, der Metriken mit Anliegen auf höchster Ebene integriert. Sie verfügen über Richtlinien, wie hochriskante Schwachstellen zuerst und in Bezug auf akzeptable Risikoniveaus gepatcht werden sollen. Sicherheitsteams führen dann tägliche und wöchentliche Scan- und Patching-Aktivitäten durch. Dieser Ansatz hilft dabei, sowohl die unmittelbaren Möglichkeiten der Ausnutzung als auch die umfassenderen Bedrohungen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, anzugehen.

